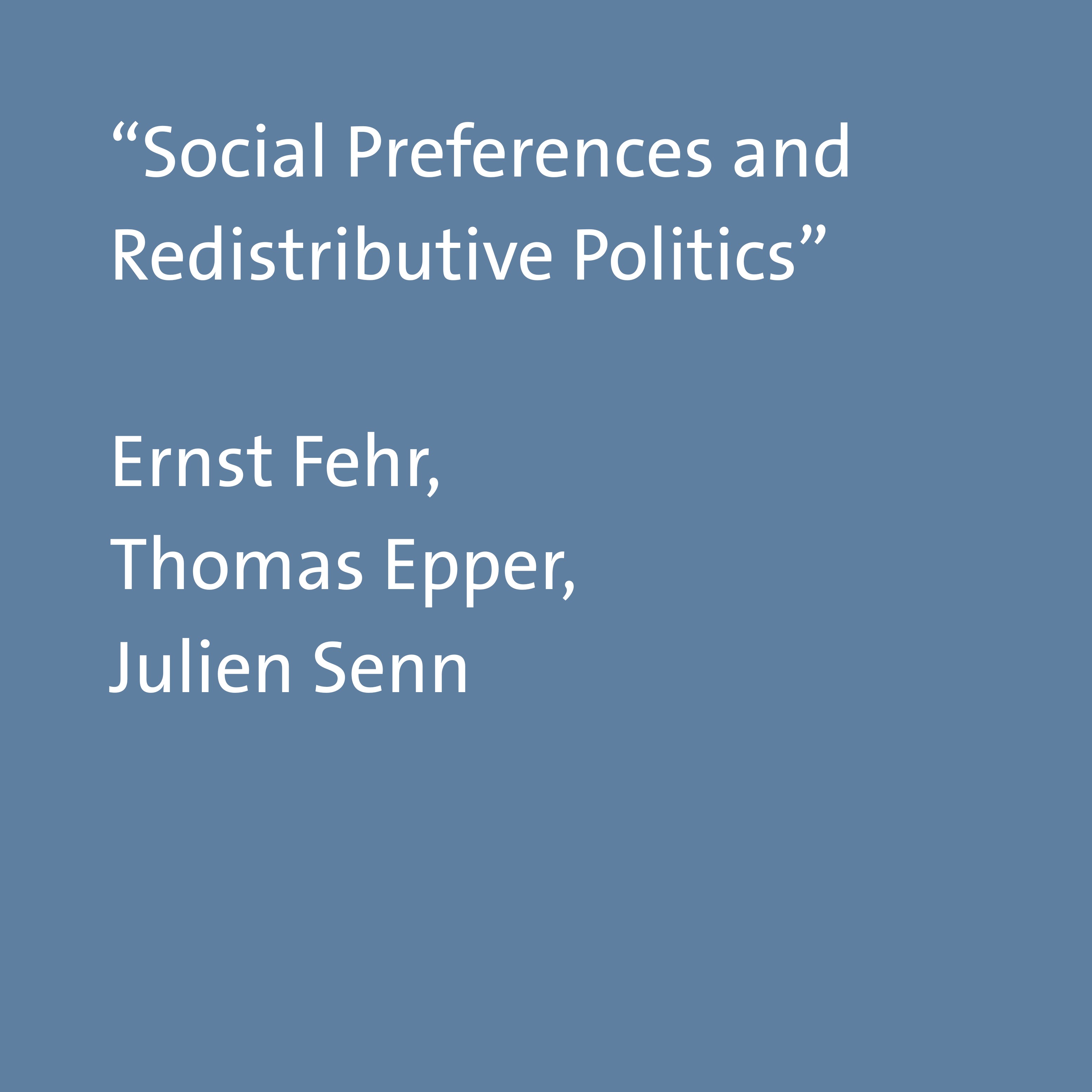Soziale Präferenzen und Umverteilungspolitik
Sollten die Reichsten stärker besteuert oder die Bedürftigen stärker subventioniert werden? Wie kann die Wirtschaftswissenschaft dazu beitragen, die unterschiedlichen persönlichen Haltungen zu Besteuerung und Umverteilung zu erklären?
(50).jpg)
Warum unterstützen manche Menschen die Besteuerung der Reichsten, während andere es eher vorziehen, Hilfsleistungen für Bedürftige zu erhöhen? Wie kann die Wirtschaftswissenschaft dazu beitragen, diese unterschiedlichen Ansichten über Besteuerung und Umverteilung zu erklären? Eine aktuelle Studie von Ernst Fehr und Julien Senn vom Department of Economics hat diese zentrale Frage untersucht. Sie betrachteten insbesondere den Zusammenhang zwischen sozialen Präferenzen, d. h. dem Ausmass, in dem Individuen sich um das Wohlergehen anderer kümmern, und der Unterstützung verschiedener umverteilungspolitischer Massnahmen.
Die Schweiz als Labor
Die direkte Demokratie der Schweiz bietet ein einzigartiges Umfeld, um politische Präferenzen zu untersuchen. Die Forschenden bildeten eine Stichprobe, die die Schweizer Bevölkerung breit repräsentiert, und fragten in einem Online-Experiment nach der öffentlichen Unterstützung für vier stark umverteilende politische Vorschläge: eine «Mindestlohn»-Initiative, eine Initiative zur Deckelung von Spitzengehältern, eine Initiative zur Einführung eines «gerechteren» Steuertarifs und eine Initiative zur Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens. Anhand der Antworten konnten die Forscher die Unterstützung für Umverteilung in ihrer Stichprobe bewerten.
Kartierung der sozialen Präferenzen der Menschen
Um soziale Präferenzen zu messen, verwendeten die Forscher eine Reihe von ökonomischen Spielen (sogenannte Diktator-Spiele), bei denen die Teilnehmer Geld zwischen sich und anderen Personen aufteilen mussten. Diese experimentelle Aufgabe erlaubt es, das Ausmass zu erfassen, in dem Individuen beim Treffen von Entscheidungen, die andere betreffen, das Wohlergehen dieser anderen berücksichtigen. Anschliessend wendeten sie einen neuartigen Clustering-Algorithmus an, um «Verhaltenstypen» zu identifizieren, d. h. Gruppen von Individuen, die sich in ähnlicher Weise verhalten. Auf diese Weise konnten sie drei klar unterscheidbare Präferenztypen mit eindeutigen Verhaltensweisen herausarbeiten: Etwa 50 % der Befragten haben eine Ungleichheitsaversion, also eine starke Abneigung gegen Ungleichheit und sind bereit, dafür zu bezahlen, diese zu reduzieren. 35 % zeigten altruistische Züge: Sie sind bereit, den Schlechtergestellten zu helfen, möchten aber den Besserverdienenden kein Geld wegnehmen. Die verbleibenden 15 % zeigten überwiegend eigennütziges Verhalten.
Wie sagen Präferenztypen die Unterstützung für Umverteilung voraus?
Inwieweit können die identifizierten Verhaltensarten die Unterstützung für tatsächliche umverteilungspolitische Vorschläge vorhersagen? Die Autoren fanden einen sehr starken und konsistenten Zusammenhang zwischen sozialen Präferenzen und der politischen Unterstützung für Umverteilung. Während Menschen mit höherem Einkommen im Allgemeinen weniger umverteilungsfreundlich eingestellt sind als solche mit niedrigerem Einkommen, zeigten die Autoren, dass soziale Präferenzen diese negative Beziehung zwischen Einkommen und Unterstützung für Umverteilung weitgehend abschwächen. Konkret stellten sie fest, dass Menschen mit Abneigung gegen Ungleichheit und altruistische Personen Umverteilung deutlich stärker unterstützen – sogar insbesondere bei höheren Einkommen – als überwiegend eigennützig eingestellte Individuen.
Die Rolle meritokratischer Überzeugungen
Die Studie beleuchtete ausserdem, wie meritokratische Überzeugungen – also der Glaube daran, ob Erfolg eher von Glück oder von Anstrengung abhängt – die Einstellung zur Umverteilung prägen. Während frühere Forschung bereits gezeigt hat, dass diese Überzeugungen ein wichtiger Faktor für die Unterstützung von Umverteilung sind, verdeutlicht diese Studie, dass ihr Einfluss davon abhängt, welche sozialen Präferenzen die Menschen haben. Meritokratische Überzeugungen sind demnach nur bei Personen mit den sozialen Präferenzen der Ungleichheitsaversion und bei den altruistischen Individuen ein signifikanter Prädiktor für die Unterstützung von Umverteilung, während sie bei überwiegend eigennützigen Personen kaum eine Rolle spielen.
Wie wichtig Gestaltung und Kommunikation von Politik ist
Ein weiteres wichtiges Ergebnis der Studie ist, dass die Art und Weise, wie umverteilende Massnahmen kommuniziert werden, die öffentliche Unterstützung beeinflussen kann. Menschen mit einer starken Abneigung gegen Ungleichheit bevorzugen tendenziell Politiken, die so dargestellt werden, dass «den Reichen etwas weggenommen wird», z. B. durch höhere Steuern für die Reichsten oder eine Deckelung der Spitzengehälter. Altruistische Personen hingegen sind solchen Initiativen gegenüber weniger aufgeschlossen. Diese Unterscheidung hat daher mögliche praktische Auswirkungen für die politische Kommunikation. Möchte eine Partei etwa vor allem Wähler ansprechen, die sich primär an Ungleichheit stören, könnte sie mit Initiativen, die auf eine stärkere Besteuerung der Reichen setzen, mehr Zuspruch erhalten. Umgekehrt könnten Parteien, die bemüht sind, eine breitere altruistische Basis anzusprechen, eher Politiken hervorheben, die die Bedürftigen unterstützen, ohne den Reichen aktiv Vermögen wegzunehmen – etwa durch Hilfen für benachteiligte Gruppen.