"Immaterielle Wirtschaft": Wachstum sichern und Umweltbelastung senken
Timo Boppart, Professor für Volkswirtschaftslehre, trägt einen Beitrag zu der Degrowth-Diskussion durch eine neue Wachstumstheorie bei.

Der Klimawandel, der massgeblich durch menschliche Aktivitäten etwa durch die Produktion materieller Güter angetrieben wird, beschleunigt sich. Mit den zunehmend spürbaren Auswirkungen der Klimaveränderung gewinnt die Theorie der Postwachstumswirtschaft immer mehr an Bedeutung, sowohl im öffentlichen Bewusstsein als auch in politischen Debatten und der Forschung. Timo Boppart, Professor für Volkswirtschaftslehre am Department of Economics, trägt gemeinsam mit seinen Co-Autoren einen Beitrag zu dieser Diskussion durch eine neue Wachstumstheorie bei. Ihr Modell untersucht eine Wirtschaft, in der Wachstum mit einem Wandel vom Konsum grundlegender Bedürfnisse hin zu hochwertigen Gütern und Dienstleistungen einhergeht. Eine Wirtschaft die sich von Quantität zu Qualität ausrichtet. Dieser Wandel führt letztlich zu einer "gewichtslosen Wirtschaft" ("weightless economy"), einem Modell, das den ökologischen Fussabdruck deutlich verringert.
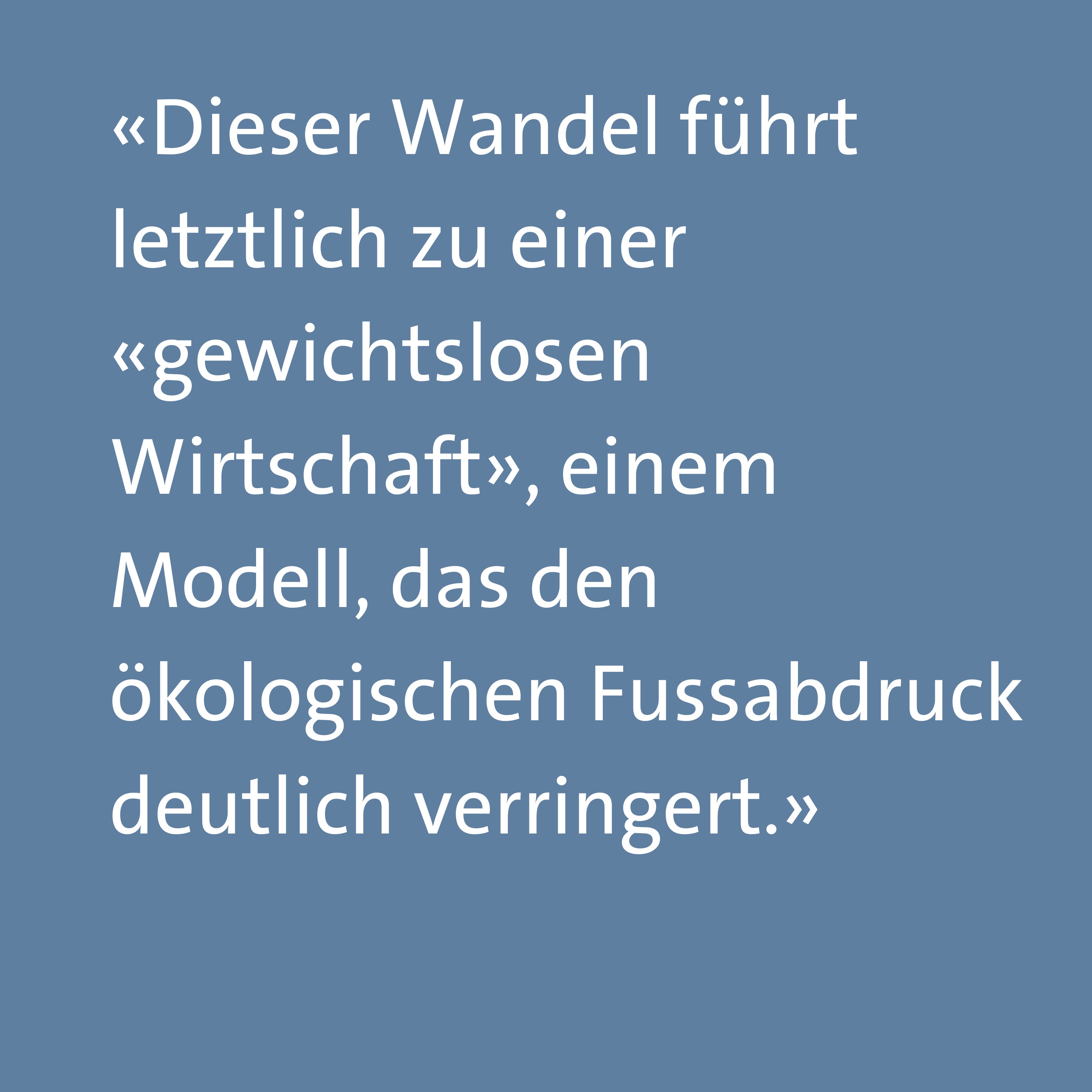
Qualität statt Quantität konsumieren
Anhand von US-Daten liefert die Studie neue Erkenntnisse über lang etablierte, hochentwickelte Volkswirtschaften. Ein zentrales Ergebnis aus der Studie ist, dass mit zunehmendem Wirtschaftswachstum und steigendem Einkommen Konsument:innen sich mehr als nur grundlegende Produkte leisten können, was die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Gütern, wie zum Beispiel Luxusartikel, verstärkt. Eine direkte Folge dieses Konsumwandels ist die Verlagerung von materialintensiver Produktion hin zu qualitätsorientiertem Konsum, was wiederum Innovation fördert. Da anspruchsvollere Produkte in der Regel weniger Emissionen pro Einheit verursachen, sinkt die Umweltbelastung pro ausgegebenem Dollar.
Darüber hinaus ermöglicht grösserer Wohlstand einen breiteren Zugang zu einem vielfältigen Dienstleistungsangebot und fördert den Konsum immaterieller Güter wie etwa Freizeitaktivitäten. Gut etablierte Volkswirtschaften stützen sich zunehmend auf den Dienstleistungssektor, der durchweg eine geringere Umweltbelastung aufweist als die Herstellung materieller Güter. Dieser Übergang zum Dienstleistungssektor stärkt die Entwicklung einer "gewichtslosen Wirtschaft" mit deutlich reduzierter Umweltwirkung. Die genaue Quantifizierung dieses Effekts stellt weiterhin eine zentrale Herausforderung dar. Diese neue Studie liefert jedoch erste Ansatzpunkte in diese Richtung.
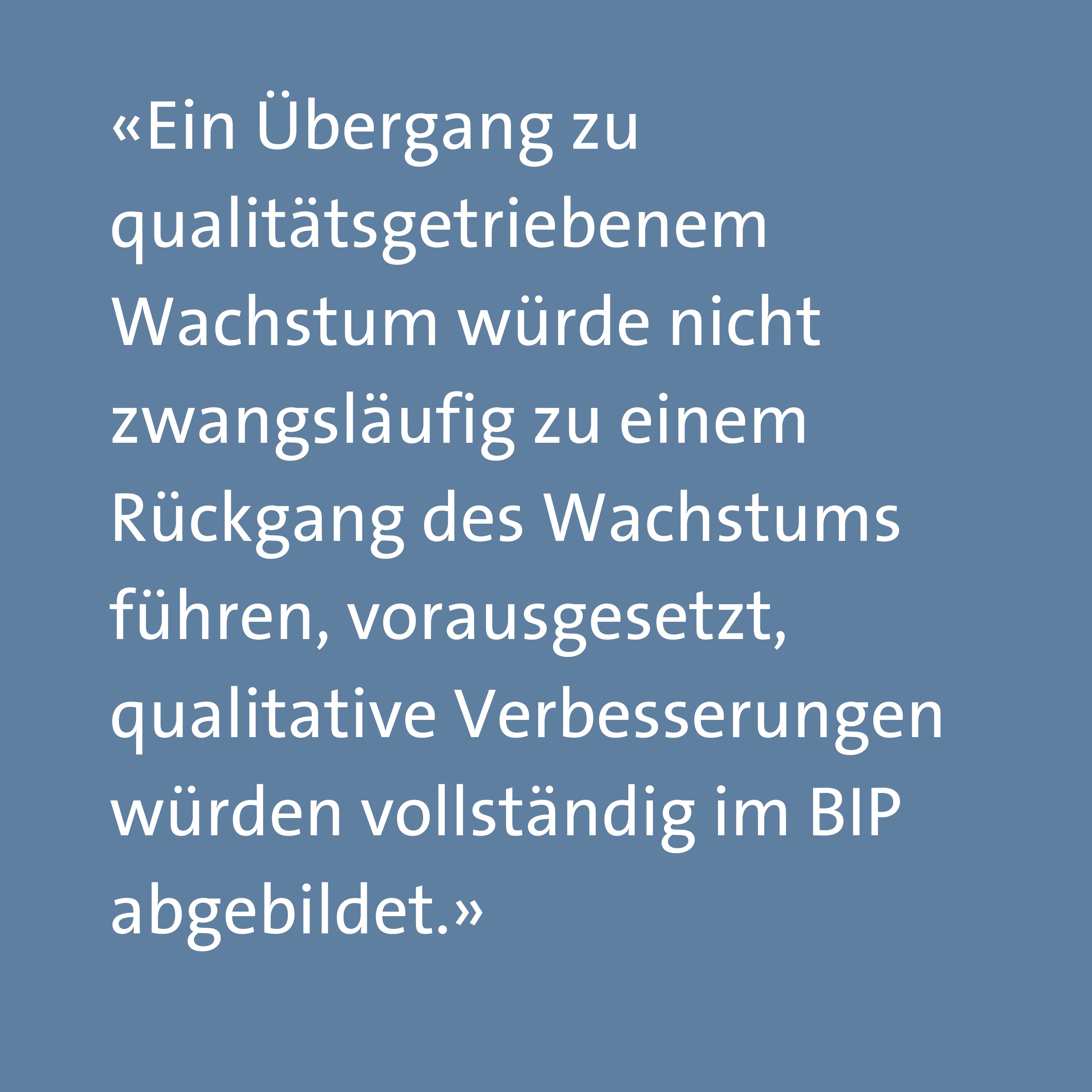
Mehr Wohlstand trotz niedrigerem BIP
Befürworter der Degrowth-Bewegung, die ein unbegrenztes Wachstums in Frage stellen, argumentieren, dass nur ein schrumpfendes BIP den Klimawandel wirksam bekämpfen könne. Die in der Studie entwickelte neue Theorie stellt diesen Ansatz infrage. Ziel sei vielmehr eine Transformation hin zu einer Wirtschaft, die von Qualität statt von Quantität getragen wird. In diesem Sinne hinterfragen die Autoren das stabile Verhältnis zwischen BIP und Emissionen, insbesondere im Rahmen einer "gewichtslosen Wirtschaft". Eine zentrale Herausforderung dieser strukturellen Transformation besteht in der Schwierigkeit, Innovationen adäquat zu messen und ihre Auswirkungen im BIP angemessen abzubilden.
Die Forschenden argumentieren, dass ein Übergang zu qualitätsgetriebenem Wachstum nicht zwangsläufig zu einem Rückgang des Wirtschaftswachstums führen würde, vorausgesetzt, qualitative Verbesserungen würden vollständig im BIP abgebildet. Allerdings könnte ein solcher Übergang dazu führen, dass das gemessene BIP-Wachstum langsamer ausfällt und die materielle Produktion schliesslich ein endogenes, begrenztes Niveau erreicht, während das qualitätsbereinigte BIP und das allgemeine Wohlergehen weiter steigen.
Aus theoretischer Sicht erscheint der Wandel hin zu einer "gewichtslosen", dienstleistungsbasierten Wirtschaft daher als geeigneter Weg in die Zukunft. Die drängende Herausforderung bleibt jedoch bestehen. Diese Transformation müsste rasch umgesetzt werden, um den dringenden ökologischen Herausforderungen wirksam entgegenzuwirken, was keineswegs garantiert ist.
Hürden im Weg
Umweltpolitische Massnahmen, wie zum Beispiel die Besteuerung materialintensiver Güter oder Subventionen für umweltfreundliche Dienstleistungen, könnten den strukturellen Wandel beschleunigen, das Wohlergehen steigern und Emissionen senken. Die grösste Hürde besteht jedoch darin, dass solche politischen Massnahmen auch Verteilungsfragen berücksichtigen müssen. Einkommensschwache Haushalte, die stärker auf materielle Grundbedürfnisse angewiesen sind, dürften vor allem solche Abgaben ablehnen – ausser es werden gezielte Ausgleichsmassnahmen getroffen.
Ein weiterer zentraler Aspekt der Studie ist die Frage, wie sich dieses neue Modell in einer offenen Volkswirtschaft entwickeln könnte. Aus dieser Perspektive kann der internationale Handel den Wandel beschleunigen, indem er das weltweite Einkommen erhöht und Innovationen in Richtung CO2-armer, dienstleistungsorientierter Aktivitäten fördert. Die Verlagerung umweltschädlicher Produktion in Länder mit schwächeren Umweltstandards birgt jedoch zusätzliche Risiken, die durch politische Massnahmen abgefedert werden müssen.
"Gewichtsloses Wachstum": ein neues Modell im Aufbau
Auch wenn die Autoren ein neues Wachstumsmodell, das auf einer Nachfrageverschiebung von Quantität zu Qualität basiert, präsentieren, betonen sie zugleich, dass dieser neue ökonomische Weg noch weitgehend unerforscht ist.
Deshalb schlagen die Forschenden weitere Aspekte vor, die noch untersucht werden müssten: die genauere Messung der Emissionen, die mit Produktqualität und neuen energieintensiven Dienstleistungen wie künstlicher Intelligenz verbunden sind; der Kauf unterschiedlicher Qualitätsstufen für einkommensstarke und einkommensschwache Haushalten zu ermöglichen; die Untersuchung freiwilliger Verschiebungen hin zu nicht-marktbasierten bzw. persönlichen Beziehungen basierenden Gütern sowie die Quantifizierung, inwieweit das derzeit verlangsamte BIP-Wachstum tatsächlich auf einen qualitätsgetriebenen Wandel zurückzuführen ist.

.jpg)