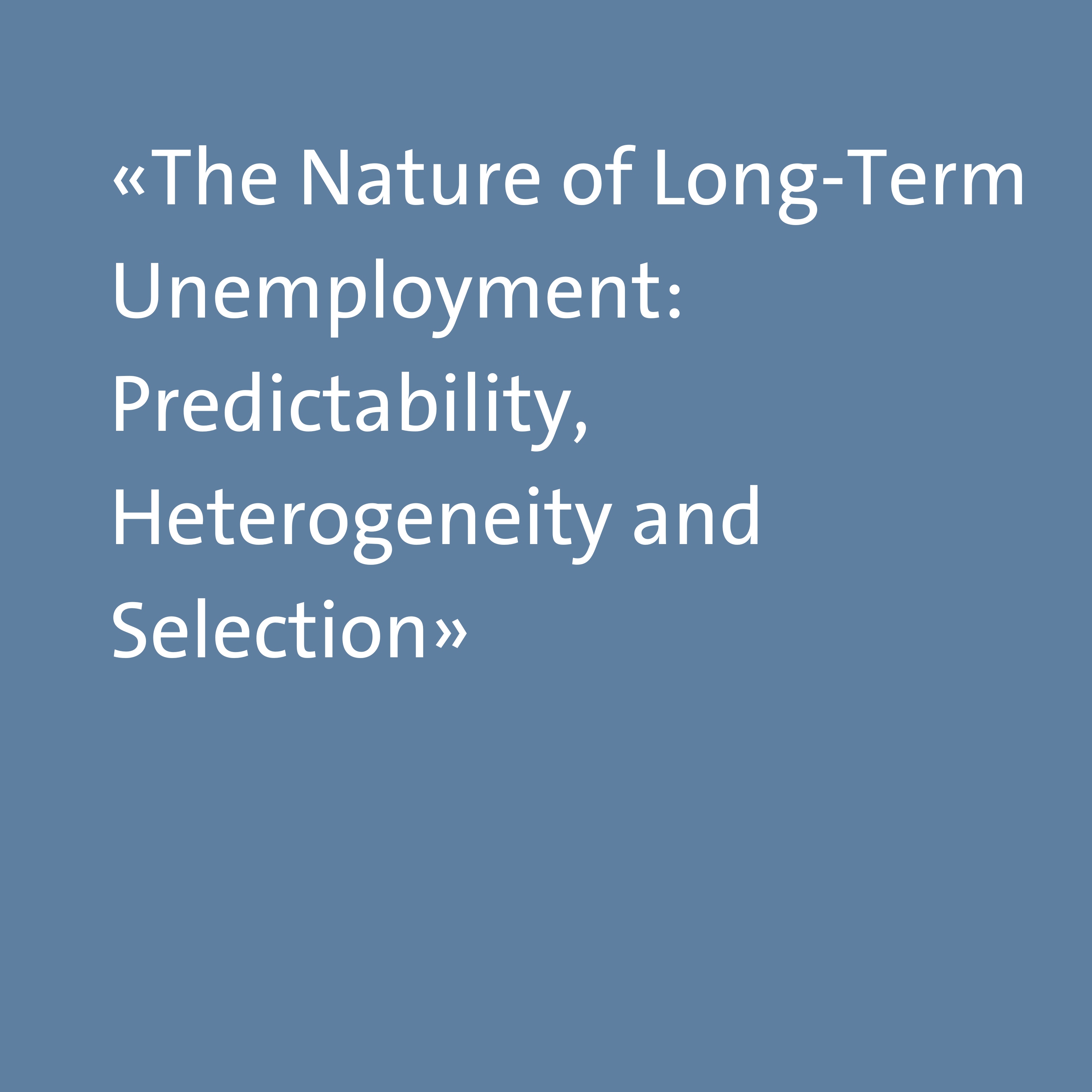Langzeitarbeitslosigkeit: Nicht nur Pech
Warum bleiben manche Menschen in der Langzeitarbeitslosigkeit stecken, während andere schnell wieder eine Beschäftigung finden? Eine neue Studie untersucht die Berechenbarkeit und verborgenen Muster der Langzeitarbeitslosigkeit.

Eine aktuelle Studie von Andreas I. Mueller, Professor für Makroökonomie und Arbeitsmärkte sowie affiliierter Professor am UBS Center, gemeinsam mit Johannes Spinnewijn (LSE), nutzt die umfassenden Daten des schwedischen Verwaltungsregisters (1992–2016), um folgende Fragen zu beantworten: Kann man vorhersagen, wer in die Langzeitarbeitslosigkeit gerät? Und warum wird es umso schwerer, Arbeit zu finden, je länger man ohne Job ist?
Ein umfassender Datensatz
Die Forschenden verknüpften Basisdaten (Alter, Bildung, Geschlecht) mit einem umfassenden Datensatz: frühere Einkommen, Beschäftigungshistorie, Leistungsbezug, frühere Arbeitgeber, Beruf, Vermögen und IQ-Werte. Diese datenreiche Grundlage ermöglichte es ihnen, ein Machine-Learning-Modell (eine Kombination aus LASSO, Gradient Boosted Trees und Random Forests) zu trainieren, welches die Wahrscheinlichkeit einer Arbeitsaufnahme innerhalb von sechs Monaten nach Beginn der Arbeitslosigkeit prognostiziert.
Das Modell erklärte rund 15 % der Variation in den tatsächlichen Wiedereingliederungsergebnissen, was mehr als doppelt so viel ist wie bei einer Vorhersage nur auf Grundlage von Basisdaten. Während Variablen wie Beruf, Vermögen oder IQ die Vorhersagegenauigkeit nur geringfügig verbesserten, lieferten andere Faktoren (insbesondere die jüngste Beschäftigungs- und Einkommenshistorie) den grössten Mehrwert. Mit anderen Worten: Je detaillierter das Hintergrundbild, desto besser die Vorhersage.
Verborgene Unterschiede
Bei Arbeitssuchenden, die wiederholt Phasen der Arbeitslosigkeit durchliefen, deckte die Analyse nicht beobachtbare Heterogenität (Differenzen, die im Datensatz nicht erfasst sind) auf, die etwa die Hälfte der beobachteten Unterschiede erklärt. Werden beide Quellen kombiniert, steigt die Untergrenze der vorhersagbaren Variation auf mindestens 19 %.
Warum es schwerer wird, Arbeit zu finden
In Schweden sinkt die Wiedereingliederungsquote stark mit der Dauer der Arbeitslosigkeit (von 70 % zu Beginn auf 55 % nach sechs Monaten). Die Studie zeigt, dass mindestens die Hälfte dieses Rückgangs auf Selektion zurückzuführen ist: Jene, die länger arbeitslos bleiben, waren von Anfang an diejenigen mit den geringeren Chancen, Arbeit zu finden.
Auch wenn Selektion ein wichtiger Faktor zur Erklärung der Langzeitarbeitslosigkeit ist, zeigt die Studie zugleich, dass in Zeiten wirtschaftlicher Abschwünge die Chancen auf eine Beschäftigung für alle sinken. Mit anderen Worten: Die Zusammensetzung der Arbeitslosen erklärt nicht den Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit in Rezessionen – ausschlaggebend ist der makroökonomische Schock selbst.
Beschäftigungsförderung neu denken
Die Studie stellt fest, dass es bereits zu Beginn einer Arbeitslosigkeit überraschend gut vorhersehbar ist, ob jemand schnell wieder einen Job findet oder lange arbeitslos bleibt. Tatsächlich entsteht ein Grossteil des Rückgangs der Einstellungswahrscheinlichkeit dadurch, dass Personen mit den geringsten Chancen länger arbeitslos bleiben – nicht nur, weil Arbeitslose mit der Zeit weniger beschäftigungsfähig würden.
Diese Erkenntnisse legen nahe, dass Arbeitsförderprogramme effektiver sein könnten, wenn sie frühzeitig diejenigen identifizieren und unterstützen, die das höchste Risiko haben. In laufender Forschung untersuchen Andreas Mueller und sein Koautor daher, wie Arbeitsuchende mit hohem bzw. niedrigem Risiko auf Beratung und Unterstützung bei der Jobsuche reagieren.