Wie viel Ungleichheit sollte eine Gesellschaft tolerieren?
Maya Eden, Professorin für Volkswirtschaftslehre an unserem Department und affiliierte Professorin am UBS Center, hielt ihre Antrittsvorlesung: „The Good“.
(47).jpg)
Sollten Lebensmittel weiterhin erschwinglich bleiben, auch wenn das bedeutet, dass die Angestellten im Detailhandel dafür unterbezahlt werden? Rechtfertigt der Zugang zu globalen Märkten den Verlust von Arbeitsplätzen in ohnehin schon benachteiligten Regionen? Solche Fragen stehen im Zentrum grundlegender politischer Entscheidungen. Immer wieder sehen sich Gesellschaften gezwungen, wirtschaftliche Effizienz gegen Gerechtigkeit abzuwägen. Doch was macht ein Ergebnis besser als ein anderes – und wer entscheidet darüber? Diese Art von Fragen bildet den Kern der Forschung von Maya Eden.

In ihrer Antrittsvorlesung an der Universität Zürich präsentierte Maya Eden einen eleganten und zugleich präzisen Ansatz, um diesen schwierigen Fragen zu begegnen. Anstatt solche Dilemmata als Ausdruck subjektiver Werte oder politischer Ideologien zu betrachten, plädiert sie dafür, den Weg zu ethischer Klarheit über grundlegende Prinzipien zu beschreiten – Prinzipien, denen die meisten Menschen intuitiv zustimmen würden. Ihre Forschung, angesiedelt an der Schnittstelle von Ökonomie und Ethik, liefert einen überzeugenden Rahmen zur Bewertung wirtschaftspolitischer Entscheidungen – von Lohnfestsetzungen über Handelsabkommen bis hin zu Fragen der Umverteilung und darüber hinaus.
Eden beginnt mit einem eingängigen, aber weitreichenden Beispiel: dem Mindestlohn. Ein niedriger Mindestlohn trägt dazu bei, Dienstleistungen erschwinglich zu halten, führt aber zu höherer Einkommensungleichheit. Ein höherer Mindestlohn verringert zwar die Ungleichheit, lässt jedoch auch die Preise steigen. Ökonom*innen können detailliert modellieren und aufzeigen, wie sich diese Zielkonflikte durch politische Veränderungen auf Preise, Beschäftigung und die Einkommensverteilung auswirken. Doch wenn die Ergebnisse einmal auf dem Tisch liegen, stellt sich eine neue Frage: Welches Ergebnis ist ethisch besser?
Zwei Prinzipien, eine ethische Rangordnung
An diesem Punkt knüpft Edens Forschung an. Gemeinsam mit Luis Mota Freitas untersucht sie, ob sich ethische Präferenzen nicht aus individueller Ideologie, sondern aus geteilten moralischen Intuitionen ableiten lassen. Zwei solcher Prinzipien bilden das Rückgrat ihres Ansatzes:
Erstens, das Pareto-Prinzip: Wenn eine Massnahme alle besser stellt, ist sie vorzuziehen.
Zweitens, das Prinzip der Gleichbehandlung: Das Wohlergehen jeder Person soll gleichwertig in die Bewertung von Ergebnissen einfliessen.
Allein betrachtet erscheinen diese Prinzipien fast selbstverständlich. Doch in Kombination führen sie zu überraschend präzisen Schlussfolgerungen: Sie erlauben oftmals nur eine einzige ethisch vertretbare Rangordnung wirtschaftlicher Ergebnisse.
Wie Eden zeigt, impliziert diese Rangordnung eine mässige, aber signifikante Aversion gegenüber Ungleichheit. Gesellschaften, die diesen beiden Prinzipien folgen, würden etwa eine gleichmässige Einkommensverteilung von 50 pro Person einer ungleichen Verteilung von 25 und 100 vorziehen – obwohl das Gesamteinkommen im zweiten Fall höher ist. Mit anderen Worten: Sie wären bereit, einen Teil des wirtschaftlichen Outputs für mehr Gerechtigkeit zu opfern.
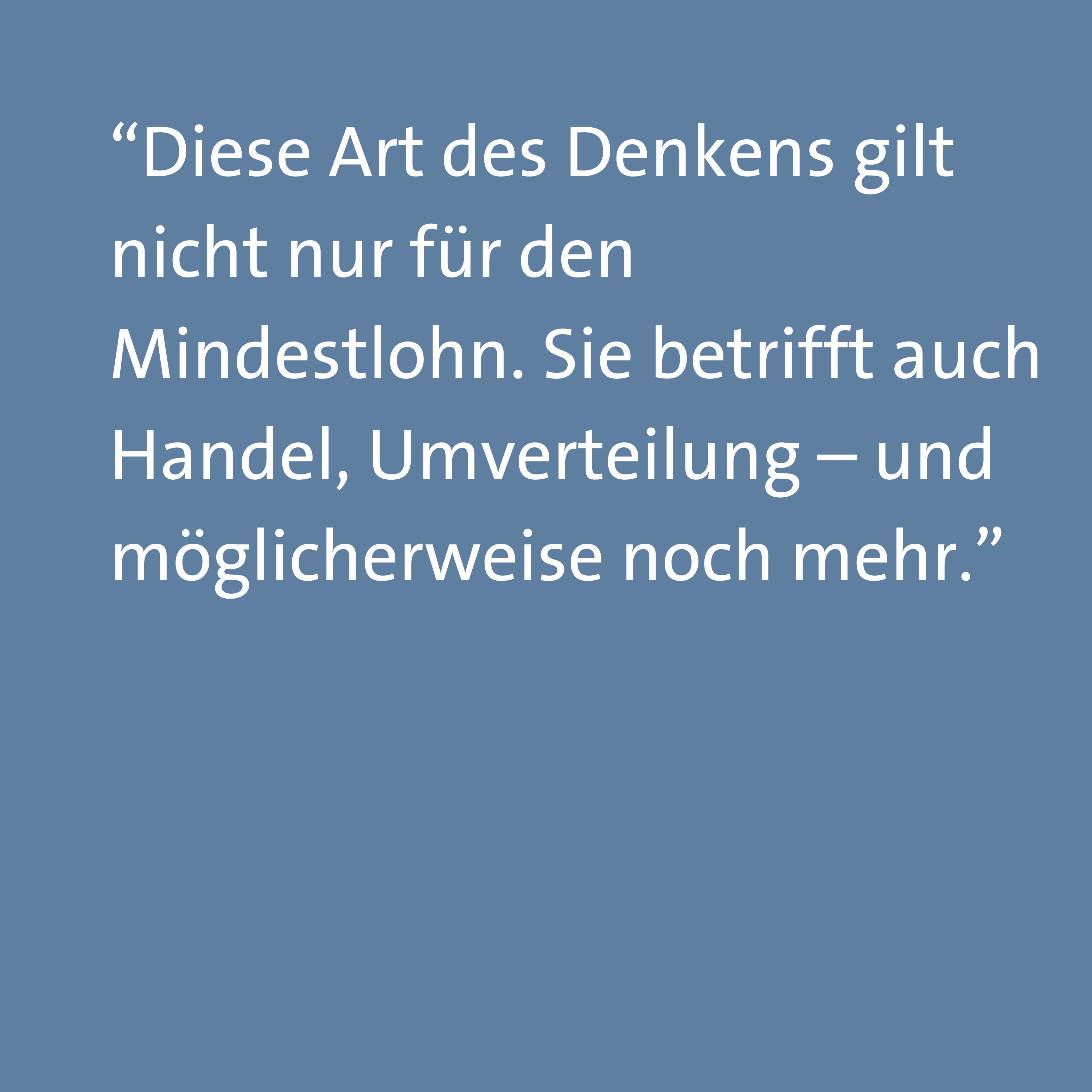
Ein allgemeiner Bewertungsrahmen für Politik
Die Stärke von Edens Ansatz liegt in seiner Allgemeingültigkeit. Die gleiche Logik, die auf Debatten um den Mindestlohn angewendet wird, lässt sich auch auf andere zentrale Politikbereiche übertragen. Handelsabkommen beeinflussen nicht nur Preise, sondern auch die Einkommensverteilung zwischen Regionen und Branchen. Auch Umverteilung durch Steuern oder Sozialtransfers hängt davon ab, wie viel Ungleichheit eine Gesellschaft bereit ist zu akzeptieren. Edens Ansatz bietet politischen Entscheidungsträgern ein Prinzipien-basiertes Instrument zur Abwägung solcher Zielkonflikte – gegründet auf ethischem Denken statt auf Machtpolitik.
Allerdings zeigt Edens Ansatz auch seine Grenzen, wenn es um die komplexesten Politikbereiche geht. Bei Fragen des Klimawandels, der Migration oder der Geburtenrate wird es deutlich schwieriger, zu definieren, wer Teil der ethischen Abwägung sein sollte. Gehören zukünftige Generationen dazu? Nicht-Einheimische? Noch ungeborene Babys? Eden erkennt, dass ihr aktuelles Modell diese Ebenen noch nicht vollständig abbilden kann – sieht darin aber eher eine Chance als ein Scheitern. Ihre Arbeit, so betont sie, sei ein Machbarkeitsnachweis: Geteilte ethische Prinzipien können ökonomisches Denken auf sinnvolle Weise prägen. Mit mehr Forschung in diesem Bereich könnte dieser Ansatz auch zur Klärung der umstrittensten politischen Fragen beitragen.
Ein neuer Zugang zu Gerechtigkeit in der Ökonomie
Was Edens Forschung auszeichnet, ist die Überzeugung, dass ökonomische Präzision und ethisches Denken einander nicht ausschliessen, sondern dass mathematisches Denken ein Werkzeug sein kann, um in einer polarisierten Welt gemeinsamen Boden zu finden. In einer Zeit, in der wirtschaftspolitische Debatten oft von Ideologie und Macht geprägt sind, bietet ihre Arbeit eine erfrischende Alternative: eine Rückkehr zur Vernunft – gegründet auf Prinzipien, die wir bereits teilen.
Maya Eden trat im Juni 2024 dem Department of Economics der Universität Zürich als Professorin für Volkswirtschaftslehre bei und ist zudem Affiliated Professor am UBS Center. Ihre Forschung umfasst ein breites Spektrum der Wohlfahrtsökonomik, Makroökonomie und der normativen Analyse wirtschaftspolitischer Massnahmen.
Antrittsvorlesung in der ehrwürdigen Aula der Universität Zürich – jenem Ort, an dem Winston Churchill 1946 seine berühmte Rede «Let Europe Arise» hielt.
Maya Eden joined the Department of Economics at the University of Zurich as Professor of Economics in June 2024 and is an Affiliated Professor at the UBS Center. Her research spans a broad spectrum of issues in welfare economics, macroeconomics and the normative analysis of economic policy.
Video der Vorlesung here
Maya Edens website.
Maura Wyler-Zerboni (Text) & Christopher Shenton (Image)