Der Welthandel ist lebenswichtig
Nach zwei Jahren bei der WTO reflektiert Ralph Ossa über Protektionismus und Wege zu einer inklusiveren Globalisierung. Ein Interview für Le Temps vom 27. Juli 2025.

Er gilt als einer der führenden Experten im internationalen Handel. Ralph Ossa empfängt Le Temps in seinem neu bezogenen Büro an der Universität Zürich, nachdem er von Januar 2023 bis Juni 2025 Chefökonom der Welthandelsorganisation (WTO) in Genf war. Eine privilegierte Position, um die Turbulenzen des Welthandels zu beobachten und mitzugestalten – zu einer Zeit, in der Protektionismus in vielen Ländern zur bevorzugten wirtschaftspolitischen Antwort geworden ist. Er erklärt die Mechanismen hinter den Verhandlungen zwischen den USA und ihren Handelspartnern – wenige Tage bevor Washington am 1. August die neuen Zölle bekannt geben will.
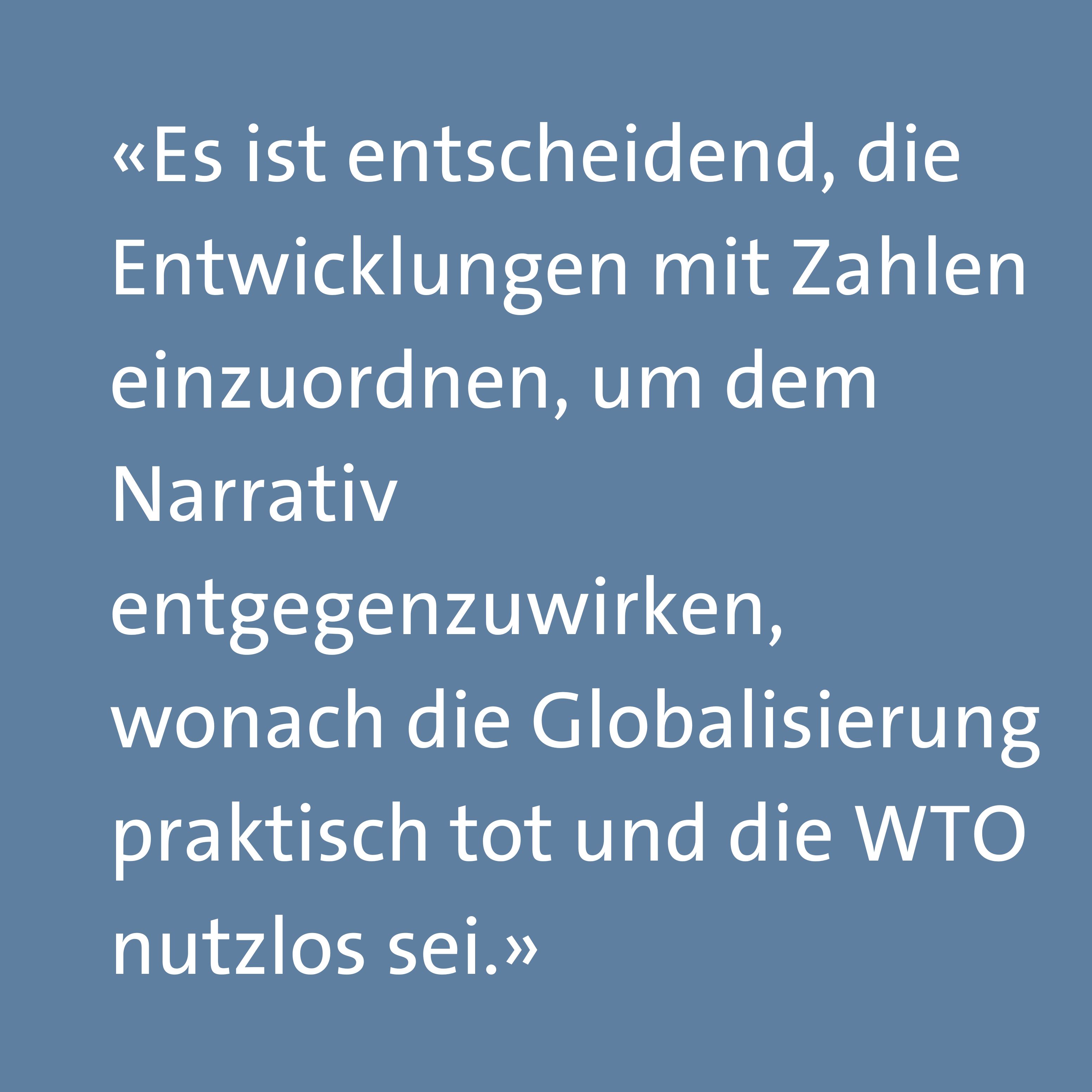
Sie konnten aus nächster Nähe beobachten, wie Globalisierung und die Rolle der WTO in den letzten Jahren zunehmend infrage gestellt wurden. Die von Donald Trump ausgelöste Handelspolitik hat diese Entwicklung verstärkt. Ist das das Ende der Globalisierung, wie wir sie kennen?
Ralph Ossa: Der Welthandel steht tatsächlich vor enormen Herausforderungen durch den wachsenden Protektionismus. Nach dem Amtsantritt der neuen US-Regierung haben wir uns bei der WTO auf Untersuchungen zu den Auswirkungen der neuen Zölle auf den Welthandel konzentriert. Es handelt sich um ein nahezu unbeackertes Feld – in der jüngeren Geschichte gibt es kaum vergleichbare Fälle mit solch weitreichenden Folgen. Klar ist: Diese protektionistischen Massnahmen werden den Handel in diesem Jahr belasten. Gleichzeitig ist es entscheidend, die Entwicklungen mit Zahlen einzuordnen, um dem Narrativ entgegenzuwirken, wonach die Globalisierung praktisch tot und die WTO nutzlos sei.
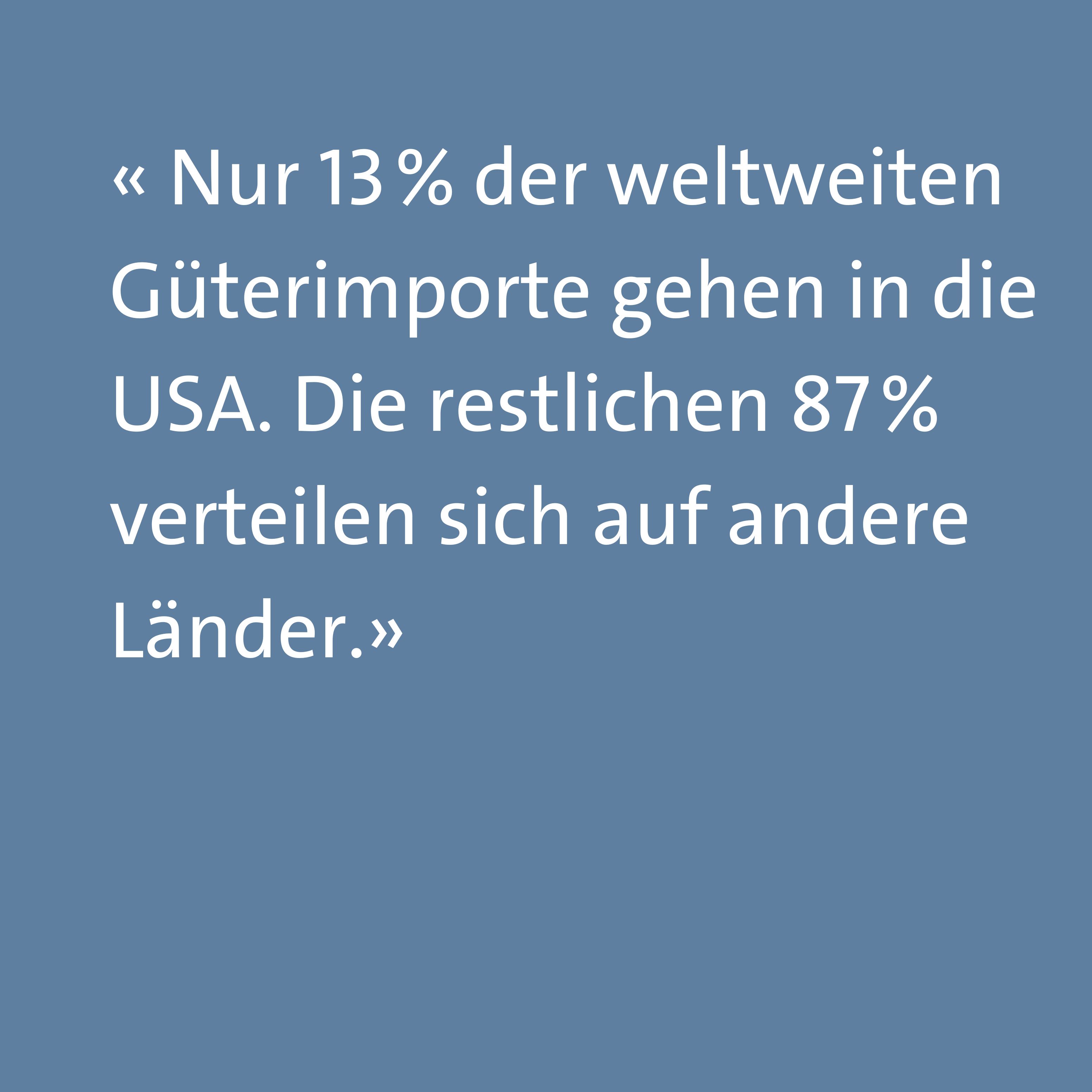
Welche Zahlen meinen Sie konkret?
Ralph Ossa:Im aktuellen Spannungsfeld zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften ist es wichtig zu betonen: Der bilaterale Handel zwischen den USA und China macht lediglich 3 % des weltweiten Warenhandels aus. Das heisst nicht, dass er unwichtig ist – aber es sind eben nur 3 %. Eine weitere relevante Zahl: Nur 13 % der weltweiten Güterimporte gehen in die USA. Die restlichen 87 % verteilen sich auf andere Länder. Der Welthandel ist also, auch wenn man die USA ausklammert, von zentraler Bedeutung.
Die WTO ist reformbedürftig, doch die von ihr entwickelten Regeln prägen den globalen Handel weiterhin. Der Anteil des Handels, der unter dem Meistbegünstigtenstatus der WTO abgewickelt wird – also zwischen Ländern, mit denen im Rahmen der WTO Zölle verhandelt wurden –, verdeutlicht das. Im Januar lag dieser Anteil bei 83 %. Er ist auf 74 % gesunken, unter anderem wegen US-Zuschlägen und Gegenmassnahmen anderer Staaten. Das heisst: Der internationale Handel lebt – und zwar unter dem Dach der WTO.
Wenn der Handel ausserhalb der USA so bedeutend ist, warum werben dann so viele Regierungen in letzter Zeit um Donald Trump?
Ralph Ossa: Für manche Länder ist der Handel mit den Vereinigten Staaten von existenzieller Bedeutung. Etwa für Kanada und Mexiko. Aber auch für sehr einkommensschwache Länder wie Lesotho.
Warum gerade Lesotho?
Ralph Ossa: Ich beziehe mich auf die Daten. Die exportierte Warenmenge aus diesem südafrikanischen Staat in die USA ist nicht sehr gross – doch rund 30’000 Arbeitsplätze in der Textilindustrie hängen dort von der Ausfuhr von Denim-Produkten in die USA ab. Einen Job in Lesotho, Vietnam oder Benin zu verlieren, ist etwas anderes, als arbeitslos in der Schweiz zu werden. Ich will die Herausforderungen für die Schweizer oder europäische Gesellschaft nicht kleinreden – aber die Mittel, auf US-Zölle zu reagieren, sind unterschiedlich. Und in der EU kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu, wenn es um Zollverhandlungen geht.
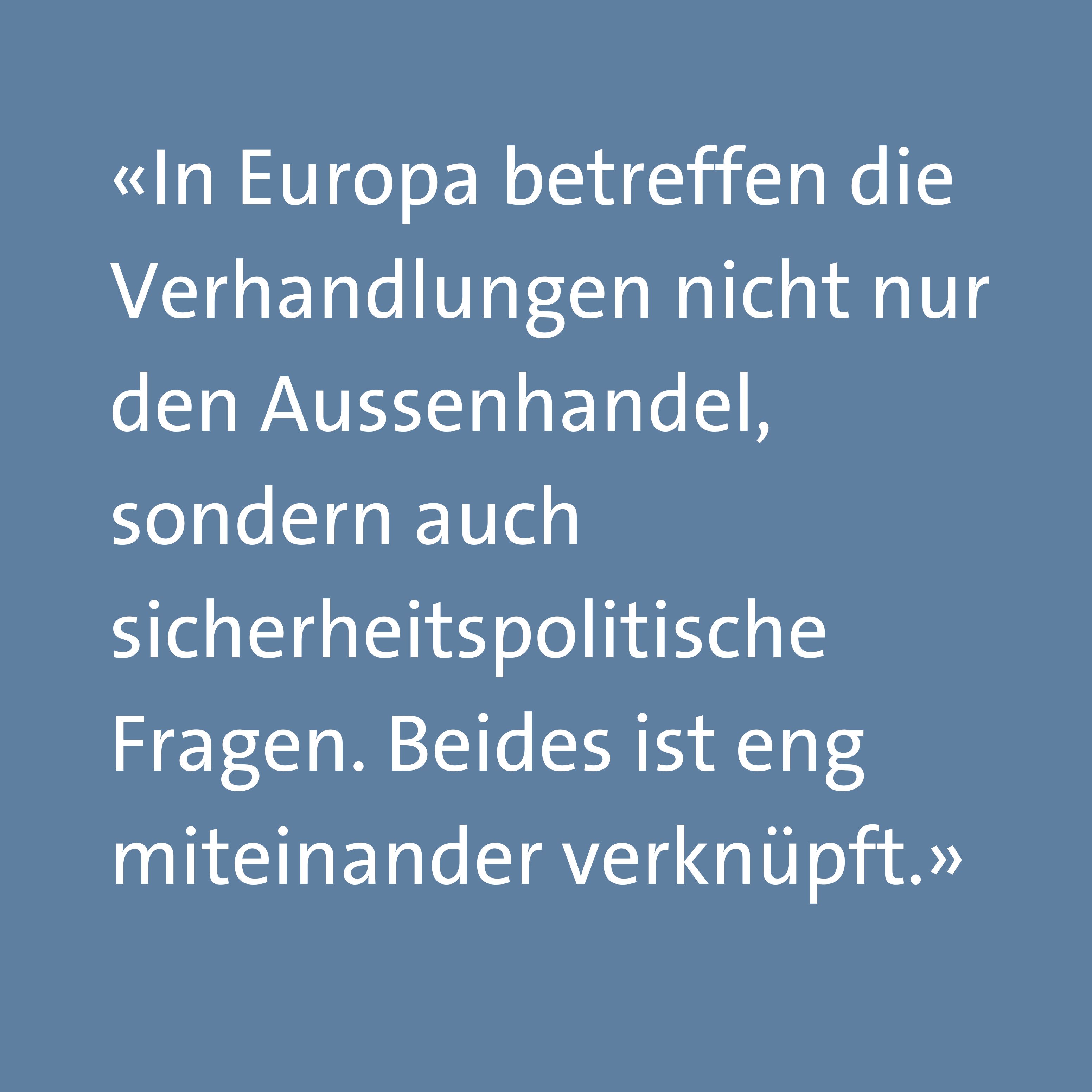
Welcher?
Ralph Ossa: In Europa betreffen die Verhandlungen nicht nur den Aussenhandel, sondern auch sicherheitspolitische Fragen. Beides ist eng miteinander verknüpft. Die Rolle der USA in der NATO oder ihre Unterstützung für die Ukraine sind entscheidend. Diese Abhängigkeiten gehen über den Handel hinaus. Ausserdem gibt es eine Dynamik, die erklärt, warum viele Länder keine besseren Vereinbarungen mit der Trump-Administration erreichen.
Was behindert diesen Verhandlungsprozess?
Ralph Ossa: Es ist die Art und Weise, wie Länder die Verhandlungen einschätzen. Die Chancen eines Landes, in den US-Markt zu exportieren, hängen natürlich von den Zöllen ab, denen es ausgesetzt ist – aber auch von den Zöllen, die für andere Länder gelten. Wenn am Ende mein Land 10 % Zoll zahlt und ein Konkurrenzland 30 %, werde ich das als Erfolg werten. Doch in Wahrheit ist es ein schlechter Deal, gerade wenn man bedenkt, dass die Zölle vor dem 2. April bei rund 2 % lagen. Die USA verfolgen in gewisser Weise das Prinzip: teile und herrsche.
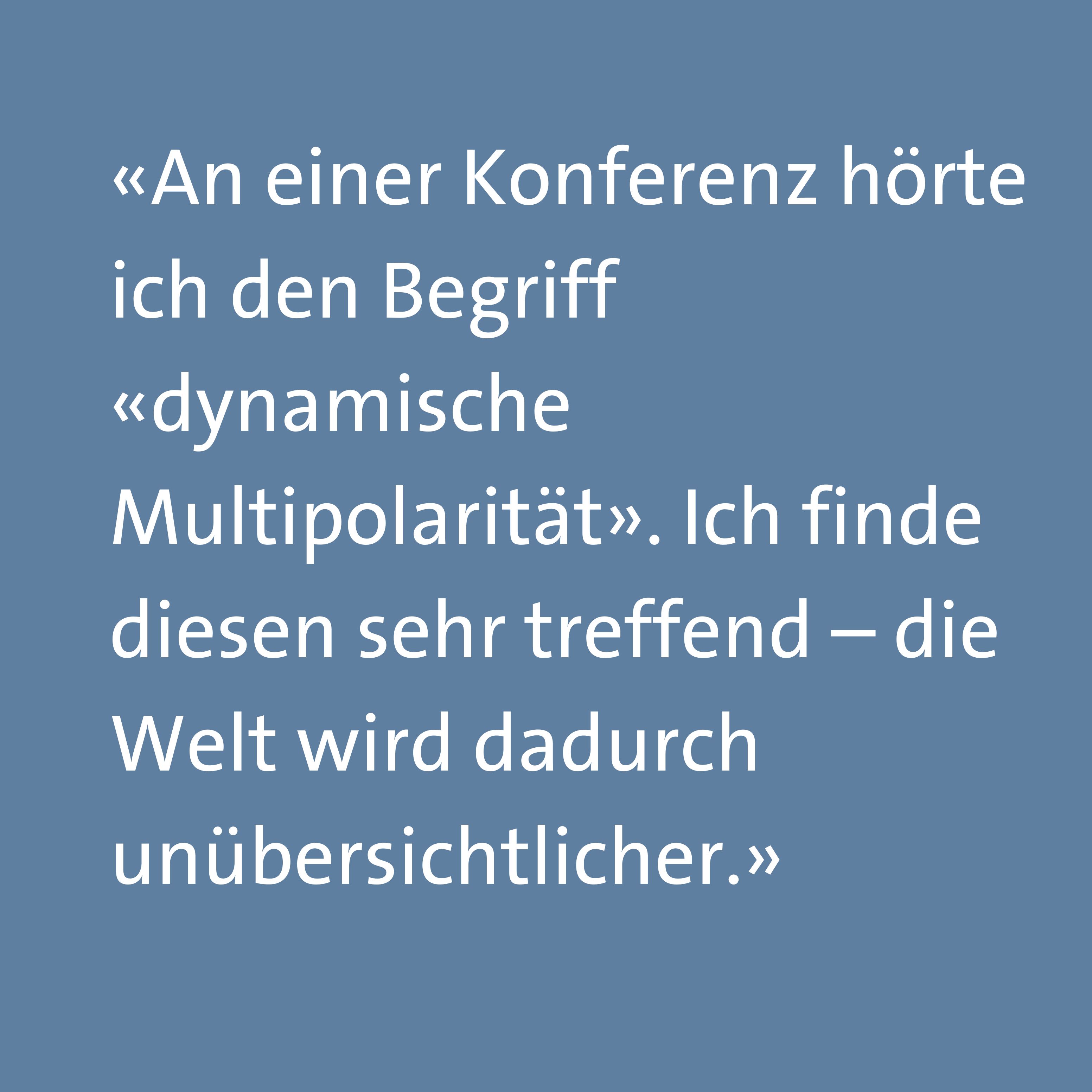
Führen die aktuellen Handelskonflikte – sei es mit den USA oder zwischen den USA und China – dazu, dass sich neue Kooperationsblöcke bilden, die sich nicht hinter einer der beiden Grossmächte positionieren wollen?
Ralph Ossa: Bei der WTO gibt es viele Länder, die sich nicht zwischen einem amerikanischen oder chinesischen Block entscheiden wollen. Natürlich zeigen die Daten gewisse Tendenzen zu geopolitischer Fragmentierung. Der Handel zwischen China und den USA-nahen Ländern wächst langsamer als jener innerhalb des Blocks von Ländern mit stärkerer Nähe zu den USA. Aber zum Beispiel Indien, das bevölkerungsreichste Land der Welt, will sich weder den USA noch China klar zuordnen – sondern als eigenständige Macht auftreten. An einer Konferenz hörte ich den Begriff «dynamische Multipolarität». Ich finde diesen sehr treffend – die Welt wird dadurch unübersichtlicher. Je nach Interessenlage eines Landes entstehen unterschiedliche Konstellationen. Das bedeutet: Ihre Partner in Sicherheitsfragen sind möglicherweise nicht dieselben wie in Handelsfragen oder beim Klimaschutz.
Globalisierung wird oft für Arbeitsplatzverluste verantwortlich gemacht, etwa durch Produktionsverlagerungen nach China. Die WTO spricht von einer «Re-Globalisierung», die verletzlichere Bevölkerungsgruppen stärker berücksichtigt. Wie kann das gelingen?
Ralph Ossa: Es stimmt, dass die Konkurrenz durch chinesische Importe den Arbeitsmarkt – insbesondere in den USA – verändert hat und Tausende Menschen ihre Jobs verloren haben. Aber ebenso wichtig ist es, die innenpolitische Dynamik in den USA zu verstehen. Die Auswirkungen des Welthandels auf das Wohlergehen der Bevölkerung hängen stark von nationalen flankierenden Massnahmen und sozialen Sicherungssystemen ab. Denken Sie an die Schweiz – sie ist sehr offen und vielen Handelsschocks ausgesetzt, und dennoch ist die Ungleichheit deutlich geringer als in anderen Ländern.
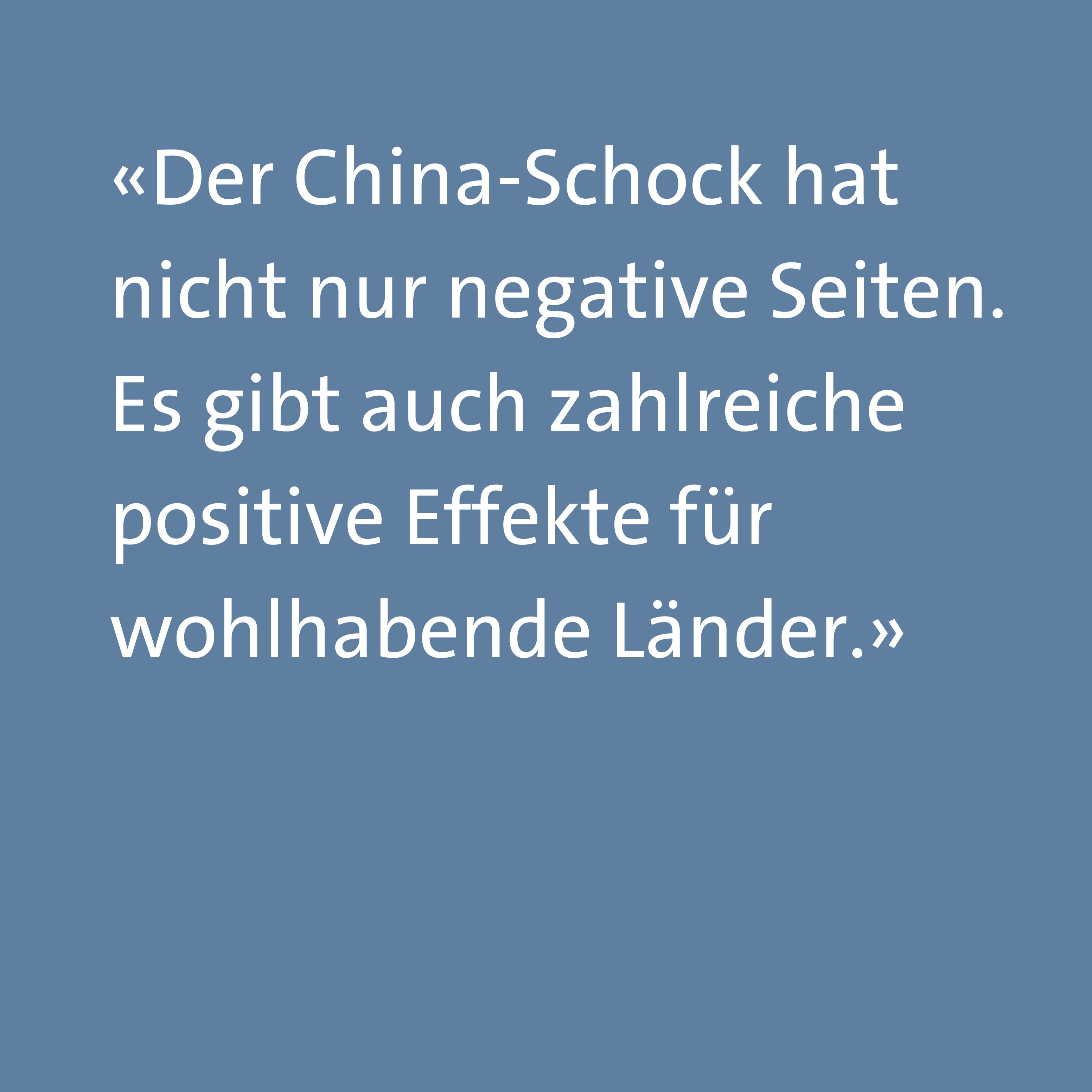
Ein weiterer Punkt ist zentral: der Aufstieg Chinas in den letzten Jahrzehnten. Selbst in akademischen Kreisen wird der sogenannte «China-Schock» oft ausschliesslich negativ betrachtet. Natürlich gibt es problematische Seiten – aber auch viele positive Effekte für wohlhabende Länder. Etwa der Zugang zu günstigen Konsumgütern. Der Aufstieg Chinas zur «Werkbank der Welt» hat Millionen Menschen aus der Armut befreit. Und westliche Firmen haben vom Wachstum dieses Marktes profitiert, indem sie dort ihre Produkte verkaufen konnten. China hat Entwicklungsländern weltweit Hoffnung gemacht. Es zeigt, dass Fortschritt möglich ist – insbesondere durch regelbasierten Handel. Die Armutsquote in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen ist von 40 % im Jahr 1995 auf heute 11 % gesunken.
Wie lassen sich die Ungleichheiten angehen, die derzeit viele Menschen in Richtung rechtspopulistischer Parteien treiben?
Ralph Ossa: Um die Probleme der Globalisierung zu bewältigen, braucht es verschiedene Massnahmen: soziale Sicherung, wie erwähnt, aber auch eine Diversifizierung von Lieferketten und Handelspartnern. In den vergangenen Jahren – sei es während der Pandemie oder im Handelskrieg – wurde deutlich, wie stark wir von China, Russland oder den USA abhängig sind. Eine Diversifikation würde es ermöglichen, auch Länder einzubinden, die bislang kaum am Welthandel teilhaben. Und sie würde unsere Abhängigkeit von einzelnen Ländern verringern. Die Schweiz verfolgt hier eine kluge Strategie: Sie verhandelt mit den USA, arbeitet mit China zusammen und schliesst gleichzeitig zahlreiche Freihandelsabkommen mit anderen Ländern ab.
Gespräch geführt von Lassila Karuta
Zum Artikel in Le Temps